
04/2017Neues aus der RechtsprechungIm Rahmen der Kostensatzverhandlungen müssen die konkreten Personalkosten nachgewiesen werden.(Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 08.06.2017, L 30 P 22/12 KL)
Die sächsische Pflegeeinrichtung, deren Träger in Berlin sitzt, forderte die zuständigen Kostenträger im Januar 2010 zu Pflegesatzverhandlungen auf. Für die Beschäftigten der Einrichtung besteht keine Tarifbindung. Die Arbeitsentgelte werden individuell vereinbart. Aus den eingereichten Unterlagen ergaben sich u.a. die Anzahl der durchschnittlich vorhandenen Pflegefach- und -hilfskräfte, die durchschnittliche Belegungszahl des Vorjahres und der prognostizierte Personalbedarf. Der Altenhilfeträger teilte ferner mit, dass seit 2008 die Personalkosten um 2,5% und die Kosten der Fremddienstleistungen um 3,5% gestiegen seien. Die Kostenträger forderten die Einrichtung daraufhin auf, u.a. weitere Angaben zum Stellenumfang, zur Eingruppierung und Alterstruktur, zur Tarifbindung und den Bruttopersonalkosten zu machen. Die Einrichtung reichte eine Tabelle ein, die keine Angaben zu den bisherigen Personalkosten enthielt. Auf nochmalige Nachfrage teilte sie mit, zur Herausgabe weiterer Unterlagen, die einen tiefergehenden Einblick in Betriebsinterna ermöglichten, sei sie nicht verpflichtet. Die Einrichtung leitete im März 2010 ein Schiedsstellenverfahren ein. Auch auf die Aufforderung des Schiedsstellenvorsitzenden, die prospektiven Kostenansätze konkret darzulegen, teilte die Einrichtung lediglich mit, dass die geforderte Erhöhung um 3,29% sich im Rahmen normaler Preiserhöhungen bewege und weitere Nachweise nicht gefordert werden könnten. Auch im weiteren Verfahren machte die Einrichtung trotz wiederholter Aufforderung keine weiteren Angaben. Daraufhin wurde nach mündlicher Verhandlung im November 2010 der Antrag auf Erhöhung der Pflegesätze durch die Schiedsstelle abgewiesen. Hiergegen erhob der Altenhilfeträger Klage vor dem Landessozialgericht. Das Gericht wies die Klage als unbegründet ab. Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts stellte das LSG klar, dass ein Heimträger jedenfalls dann die konkreten Personalkosten nachweisen muss, wenn diese Ausgaben von den Kostenträgern bestritten werden, was vorliegend der Fall gewesen war. Eine pauschale Kalkulation reiche regelmäßig nicht aus. Es müssen vielmehr konkrete Belege für die Kalkulation vorgelegt werden, um deren Plausibilität zu prüfen. Es handele sich auch entgegen der Rechtsauffassung des Heimträgers nicht um einen wettbewerbswidrigen Eingriff in die Rechtssphäre einer Pflegeeinrichtung, diese zur Vorlage konkreter Nachweise zu verpflichten. Aus Sicht des Gerichts war der Träger auch deshalb zur Vorlage weiterer Nachweise verpflichtet, weil die geforderten Pflegevergütungen oberhalb des unteren Drittels vergleichbarer Pflegevergütungen in der Region lagen. Um in einem solchen Fall eine Entgelterhöhung durchsetzen zu können, müsse der Heimträger nachweisen, dass eine besondere Situation vorliegt, die die höheren Pflegesätze rechtfertigt. Anmerkung: Die Entscheidung des LSG verdeutlicht noch einmal, dass das durchaus berechtigte wirtschaftliche Interesse von Pflegeeinrichtungen auf Wahrung ihrer Betriebsgeheimnisse jedenfalls in den Kostensatzverhandlungen zurückstehen muss. Die Verhandlungspartner verhandeln die Vergütungen nicht nur im Verhältnis zueinander, sondern auch für betroffene Dritte, da die Bewohner der Einrichtungen und ggf. die zuständigen Sozialhilfeträger zur teilweisen Entrichtung der Vergütungen verpflichtet sind. Hierdurch erwächst den Einrichtungen eine erhöhte Pflicht zum Nachweis ihrer Kosten. Unter bestimmten Voraussetzungen haftet ein gesetzlicher Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigter direkt gegenüber dem Pflegeheim.(Urteil des LG Dortmund vom 11.01.2017, 7 O 274/15)Das Landgericht Dortmund hatte darüber zu entscheiden, ob eine Vorsorgebevollmächtigte die offenen Heimkosten ihrer mittlerweile verstorbenen Mutter als Schadensersatz gegenüber dem Heim auszugleichen hatte. Im März 2012 schlossen das Pflegeheim und die Bewohnerin vertreten durch ihre Tochter als Vorsorgebevollmächtigte einen Heimvertrag ab. Im Rahmen dieses Vertragsabschlusses machte das Heim deutlich, dass der Vertrag nur abgeschlossen wird, wenn die Vorsorgebevollmächtige zusichert, dass der monatliche Eigenanteil an den Heimkosten und die Telefonkosten aus den Rentenzahlungen der Mutter an das Heim beglichen werden. Die Pflegeeinrichtung wies explizit darauf hin, dass es ihr entscheidend darauf ankam, dass die Vorsorgebevollmächtigte dafür Sorge trägt, dass der monatliche Heimkostenanteil vom Konto ihrer Mutter an das Heim weitergeleitet wird. Die Vorsorgebevollmächtigte sicherte dies ausdrücklich zu. Bis zum Versterben der Mutter im März 2015 überwies die Vorsorgebevollmächtigte zu keinem Zeitpunkt den Eigenanteil an das Heim, sondern verbrauchte das Geld für sich selbst. Die Einrichtung forderte sie wiederholt zur Zahlung auf und schaltete dann einen Rechtsanwalt ein. Es waren offene Heimkosten, Rechtsanwaltsgebühren und Mahnverfahrenskosten in Höhe von insgesamt 11.330,69 € über die Jahre aufgelaufen. Das Pflegeheim forderte die offene Gesamtsumme als Schadensersatz von der Tochter und erhob Klage vor dem Landgericht. Das Gericht gab der Klage vollumfänglich statt. Aus seiner Sicht hatte die Tochter als Vorsorgebevollmächtigte bei Abschluss des Heimvertrags eine Zusicherung über die Weiterleitung der Gelder an das Heim abgegeben. Zwar sei sie selbst nicht Vertragspartnerin des Heimvertrags, aber die Haftung ergebe sich daraus, dass zwischen dem Heim und der Tochter ein eigenes Schuldverhältnis nach § 311 Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) entstanden sei, weil die Tochter mit der Zusicherung der Weiterleitung der Rente der Mutter an das Heim in besonderem Maße Vertrauen in Anspruch genommen habe und nur dadurch das Zustandekommen des Heimvertrags bewirkt habe. Anmerkung: Grundsätzlich haftet der gesetzliche Betreuer oder der Vorsorgebevollmächtigte nur gegenüber dem Betreuten bzw. gegenüber dem Vollmachtgeber. Dies führt immer wieder zu der ärgerlichen Situation, dass die Heime den Betreuten bzw. Vollmachtgeber nicht oder nicht mehr in Anspruch nehmen können und zugleich keinen direkten Schadensersatzanspruch gegenüber dem gesetzlichen Betreuer bzw. Vorsorgebevollmächtigten geltend machen können, obwohl letztlich durch dessen Handeln oder Unterlassen ein Schaden entstanden ist. Das Landgericht Dortmund hat nun einen Weg aufgezeigt, wie in bestimmten Fällen die Geltendmachung von Schadensersatz gegenüber dem gesetzlichen Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigten doch möglich sein kann. Nimmt dieser nachweislich bei Abschluss des Heimvertrags besonderes Vertrauen in Anspruch, indem er ein bestimmtes Handeln zusichert, so haftet er direkt gegenüber dem Pflegeheim, wenn er später nicht so handelt, wie er es zugesichert hatte und dem Heim dadurch ein Schaden entstanden ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Heim nicht nur ein bestimmtes Handeln verlangt, sondern dass es auch sehr deutlich macht, dass der Heimvertrag nur zustande kommt, weil der gesetzliche Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigte ein bestimmtes Handeln zugesichert hatte. Das kann wie vorliegend die Weiterleitung der Rente der Bewohnerin sein, das kann aber beispielsweise auch sein, sämtliche erforderliche Anträge an die Pflegekasse und das Sozialamt zu stellen (vgl. AG Recklinghausen, Urteil vom 23.09.2014, 11 C 137/14). Im Streitfall muss das Heim beweisen können, dass es den Vertragsschluss von der Zusicherung abhängig gemacht hat. Es muss also in der Lage dazu sein, Zeugen zu benennen, die den entsprechenden Gesprächsverlauf bestätigen können oder etwas Schriftliches vorzulegen, aus dem sich die Zusicherung ergibt. Hinweis für Berliner AltenpflegeeinrichtungenBitte beachten Sie das Auslaufen erster Übergangsfristen der Wohnteilhabe-Bauverordnung zum 31.12.2018.
Pflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Tagespflege fallen gemäß § 3 Absatz 2 Wohnteilhabegesetz Berlin in Verbindung mit § 1 Wohnteilhabe-Bauverordnung (WTG-BauV) in deren Anwendungsbereich. § 21 WTG-BauV regelt u.a. bestimmte Übergangsfristen zur Vornahme baulicher Veränderungen durch Bestandseinrichtungen. Gemäß § 21 Absatz 3 und Absatz 6 WTG-BauV läuft für bestimmte bauliche Veränderungen eine erste Übergangsfrist zum 31.12.2018 aus. Beispielhaft (keine vollständige Aufzählung) seien hier genannt:
Es könnten teilweise erhebliche bauliche Veränderungen erforderlich sein, so dass den Einrichtungen, die sich bisher noch nicht mit den Anforderungen der WTG-Bauverordnung befasst haben, dringend anzuraten ist, sich bereits am Jahresanfang 2018 mit sämtlichen Anforderungen zu beschäftigen und die ggf. erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2018!Klicken Sie hier, wenn Sie den Newsletter Altenpflege abbestellen möchten. |

|
Impressum: Christine Vandrey & Barbara Hoofe |
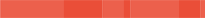


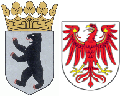 Das
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hatte über die Rechtmäßigkeit
eines Schiedsspruches im Rahmen von Kostensatzverhandlungen zu
entscheiden. Hier war u.a. streitig, ob die aktuellen Personalkosten von
einer Altenpflegeeinrichtung anhand von Belegen nachgewiesen werden
mussten.
Das
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hatte über die Rechtmäßigkeit
eines Schiedsspruches im Rahmen von Kostensatzverhandlungen zu
entscheiden. Hier war u.a. streitig, ob die aktuellen Personalkosten von
einer Altenpflegeeinrichtung anhand von Belegen nachgewiesen werden
mussten.