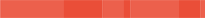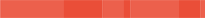Neues aus der Rechtsprechung
Bewohner in stationären Behindertenhilfeeinrichtungen mit
Pflegestufe haben keinen Anspruch auf häusliche Krankenpflege durch die
gesetzliche Krankenversicherung
(Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 20.09.2013, L 1 KR 90/12)
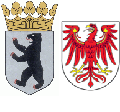 Das
Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg hatte darüber zu
entscheiden, ob ein Bewohner in einer stationären
Behindertenhilfeeinrichtung, bei dem eine Pflegestufe durch die
Pflegekasse festgestellt ist, Anspruch auf häusliche Krankenpflege gemäß
§ 37 SGB V gegen seine gesetzliche Krankenkasse hat.
Das
Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg hatte darüber zu
entscheiden, ob ein Bewohner in einer stationären
Behindertenhilfeeinrichtung, bei dem eine Pflegestufe durch die
Pflegekasse festgestellt ist, Anspruch auf häusliche Krankenpflege gemäß
§ 37 SGB V gegen seine gesetzliche Krankenkasse hat.
Das LSG kam zu dem Ergebnis, dass der Bewohner
keinen Anspruch auf Kostenübernahme gegenüber seiner Krankenkasse hat,
da die Pflegekasse mit dem monatlichen Zuschuss zu den Heimkosten von
maximal 256,- € gemäß § 43a SGB XI auch die Kosten der
qualifizierten Behandlungspflege abgegolten haben soll. § 43a Satz 1 SGB
XI verweist auf § 43 Abs. 2 SGB XI. Dort ist geregelt, dass auch die
Leistungen der medizinischen Behandlungspflege von den Entgelten für
stationäre Pflegeeinrichtungen mitumfasst sein sollen. Aus Sicht des
Gerichts kann die Verweisung auf § 43 Abs. 2 SGB XI nur so
verstanden werden, dass mit dem Zuschuss der Pflegekasse zum Heimentgelt
in Behindertenhilfeeinrichtungen die Kosten der medizinischen
Behandlungspflege abgegolten sind.
Das LSG kommt damit zu dem Ergebnis, dass die Kosten
der häuslichen Krankenpflege weder von der Krankenkasse, noch vom
Sozialhilfeträger, sondern von der Einrichtung zu tragen sind, da die
Einrichtung durch den Zuschuss der Pflegekasse aus Sicht des Gerichts
bereits die Kosten der qualifizierten Behandlungspflege refinanziert
erhalten hat.
Anmerkung:
Das LSG Berlin-Brandenburg
verkennt in seinem Urteil, dass die stationären
Behindertenhilfeeinrichtungen durch den Zuschuss der Pflegekassen, der
direkt an die Sozialämter gezahlt wird, keine höhere Vergütung erhalten.
Tatsächlich wird der Zuschuss durch die Sozialämter zur Dämpfung der
eigenen Ausgaben eingesetzt. Konsequent wäre es daher gewesen, den
Sozialhilfeträger zur Übernahme der Kosten der häuslichen Krankenpflege
zu verurteilen und nicht die Einrichtung.
Es bleibt zu hoffen, dass das Bundessozialgericht
(BSG) in absehbarer Zeit darüber entscheidet, wer die Kosten der
qualifizierten Behandlungspflege in stationären
Behindertenhilfeeinrichtungen zu tragen hat. Bedauerlicherweise ist
diese dringend zu klärende Rechtsfrage bisher nicht beim BSG anhängig.
(Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 06.05.2013, S 47 SO 843/09)
 Das
Sozialgericht (SG) Berlin hatte darüber zu entscheiden, unter welchen
Voraussetzungen ein Sozialhilfeträger mit einem Leistungserbringer von
Eingliederungshilfe eine Leistungsvereinbarung zu schließen hat, wenn
der vorgesehene Leistungstyp bisher nicht im Landesrahmenvertrag
geregelt ist.
Das
Sozialgericht (SG) Berlin hatte darüber zu entscheiden, unter welchen
Voraussetzungen ein Sozialhilfeträger mit einem Leistungserbringer von
Eingliederungshilfe eine Leistungsvereinbarung zu schließen hat, wenn
der vorgesehene Leistungstyp bisher nicht im Landesrahmenvertrag
geregelt ist.
Der Kläger, ein Erbringer von ambulanten Leistungen
im Bereich Eingliederungshilfe, beantragte bei dem beklagten
Sozialhilfeträger im Jahr 2008 den Abschluss einer Leistungsvereinbarung
für den neuen Leistungstyp "ambulante heilpädagogische Hilfen für
Menschen mit geistiger Behinderung und gravierenden (stark ausgeprägten)
Verhaltensauffälligkeiten". Bereits seit dem Jahr 2000 bemühte er sich
um den Abschluss einer entsprechenden Leistungsvereinbarung. Die
entsprechenden Hilfen erbrachte er bisher im Rahmen des BEW. Das Land
Berlin lehnte den Abschluss einer entsprechenden Leistungsvereinbarung
mit der Begründung ab, dass ein Bedarf an entsprechenden Leistungen kaum
gegeben sei und daher ein neuer Leistungstyp nicht erforderlich sei.
Ein Antrag im einstweiligen Rechtsschutz auf
vorläufigen Abschluss einer Leistungs- und Prüfungsvereinbarung wurde im
Jahr 2009 vom SG Berlin mangels Eilbedürftigkeit abgewiesen. Im
Hauptsacheverfahren gab das Gericht der Klage statt und verpflichtete
das Land Berlin zum Abschluss einer Leistungs- und Prüfungsvereinbarung
für den neuen Leistungstyp.
Grundsätzlich hat der Leistungserbringer aus Sicht
des Gerichts nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung
gegen den Sozialhilfeträger, wenn er von diesem den Abschluss einer
Leistungs- und Prüfungsvereinbarung begehrt. Diese Ermessensentscheidung
beziehe sich sowohl darauf, ob überhaupt ein Vertrag zu schließen sei
und welche Inhalte dieser Vertrag habe. Hinsichtlich des Abschlusses des
Vertrags kann der Sozialhilfeträger prüfen, ob der Leistungserbringer
leistungsfähig ist und ob die Vergütung nicht höher als bei anderen
Leistungserbringern ist. Aus Sicht des Gerichts darf der beklagte
Sozialhilfeträger aber nicht überprüfen, ob überhaupt ein Bedarf an der
Leistung besteht. Ferner müsse der Sozialhilfeträger auch dann eine
Ermessensentscheidung auf Abschluss einer Leistungsvereinbarung treffen,
wenn der Leistungstyp noch nicht im Berliner Rahmenvertrag geregelt
ist.
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass das Ermessen
des Beklagten vorliegend auf Null reduziert war, er also die Leistungs-
und Prüfungsvereinbarung mit dem Kläger schließen musste, da dieser
leistungsfähig und geeignet für die Leistungserbringung ist und das
Angebot mangels eines externen Vergleichs alternativlos ist.
Hinweis:
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Berufung ist beim LSG Berlin-Brandenburg (L 15 SO 153/13) anhängig.
(Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 30.10.2013, XII ZB 482/13)
Die Betroffene wurde auf Anordnung ihres
gesetzlichen Betreuers in einem psychiatrischen Krankenhaus zur
zwangsweisen Heilbehandlung stationär untergebracht. Diese Unterbringung
und Zwangsbehandlung wurde durch das zuständige Amtsgericht im Wege der
einstweiligen Anordnung genehmigt. Nach Einholung einer fachärztlichen
Stellungnahme des behandelnden Arztes wurde die Genehmigung für weitere
zwölf Wochen ausgesprochen.
Auf die Beschwerde der Betreuten holte das
zuständige Landgericht ein gerichtliches Gutachten durch den
behandelnden Oberarzt der Klinik ein, das dieser in einem
Anhörungstermin unter Anwesenheit aller Beteiligten mündlich abgab. Er
stellte die Erforderlichkeit der Unterbringung und zwangsweisen
Behandlung fest.
Hiergegen legte die Betroffene erfolgreich
Rechtsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof (BGH) ein. Der BGH hob die
Entscheidung auf und verwies die Angelegenheit zurück an das
Landgericht.
Aus Sicht des Gerichts wurden die formellen
Voraussetzungen zur Unterbringung mit Zwangsbehandlung nicht
eingehalten. Gemäß § 321 Abs. 1 FamFG, der zuständigen Verfahrensordnung
in Betreuungssachen, ist vor Durchführung der Unterbringungsmaßnahme
eine förmliche Beweisaufnahme über deren Erforderlichkeit durchzuführen.
Der Gutachter soll dem Betroffenen vorher bekannt gegeben werden, damit
dieser von seinem Ablehnungsrecht Gebrauch machen kann. Der
Sachverständige soll die betroffene Person vor Erstellung des Gutachtens
persönlich untersuchen oder befragen. Der BGH hält es im Hinblick auf
den erheblichen Grundrechtseingriff der Unterbringungsmaßnahme mit
Zwangsbehandlung auch für fraglich, ob ein mündliches Gutachten
ausreicht. Jedenfalls muss dieses Gutachten detailliert auf Art und
Ausmaß der Erkrankung unter Einbeziehung der Vorgeschichte eingehen und
wissenschaftlich belegt darstellen, warum die Zwangsmaßnahmen
erforderlich sind.
Der BGH bemängelt weiterhin, dass ein Verstoß gegen §
321 Abs. 1 S. 5 FamFG vorliegt, wonach der gerichtliche Sachverständige
nicht der Arzt sein soll, der die Zwangsbehandlung durchführt. Mit der
Anordnung der Zwangsbehandlung werde gravierend in die Grundrechte der
Betroffenen eingegriffen. Daher soll ein unabhängiger Gutachter die
Erforderlichkeit der Zwangsbehandlung bestätigen. Nur in eng begrenzten
Ausnahmefällen, wie bspw. besonderer Eilbedürftigkeit, dürfe
ausnahmsweise der behandelnde Arzt als Gutachter herangezogen werden.
Hinweis:
Anders ist dies bei einer reinen
Unterbringungsmaßnahme ohne Zwangsbehandlung. Hier kann das Gericht den
behandelnden Arzt bei einer Unterbringung bis zu vier Jahren als
Gutachter heranziehen (§ 329 Abs. 2 FamFG).
Durchführung eines Unterbringungsverfahrens zur Zwangsbehandlung
Die gesetzlichen Regelungen zur Anordnung einer Unterbringung mit ärztlicher Zwangsbehandlung wurden im Jahr 2013 reformiert.
Die Unterbringung zur Zwangsbehandlung eines
Betreuten ist nunmehr an strenge Voraussetzungen geknüpft. Danach ist
eine Zwangsbehandlung nur bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen
zulässig:
Dem
Betreuten fehlt auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer
geistigen oder seelischen Behinderung die Einsichtsfähigkeit in die
Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme oder er kann nicht nach dieser
Einsicht handeln,
es wurde zuvor versucht, den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen,
die
ärztliche Zwangsmaßnahme ist zum Wohl des Betreuten erforderlich, um
einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden,
der erhebliche gesundheitliche Schaden kann durch keine andere dem Betreuten zumutbare Maßnahme abgewendet werden und
der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme überwiegt die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich.
Der
gesetzliche Betreuer hat die Unterbringung und die Zwangsbehandlung
anzuordnen. Das Betreuungsgericht muss die angeordneten Maßnahmen
genehmigen und hierfür zuvor ein ärztliches Gutachten zur Notwendigkeit
der Unterbringung und der ärztlichen Zwangsmaßnahmen einholen. Die
Genehmigung durch das Betreuungsgericht erfolgt zeitlich befristet.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Mandanteninfo.
Logo © Landessozialgericht Berlin-Brandenburg.
Foto © Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz