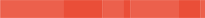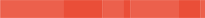Neues aus der Rechtsprechung
Bewohner von Einrichtungen der Eingliederungshilfe haben Anspruch auf Versorgung mit häuslicher Krankenpflege.
(Urteile des BSG vom 25.02.2015, B 3 KR 10/14 R und B 3 KR 11/14 R)
 Das
Bundessozialgericht hat in zwei Verfahren entschieden, dass
Einrichtungen der Eingliederungshilfe ein "sonst geeigneter Ort" im
Sinne des § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V sein können, so dass die dortigen
Bewohner Anspruch auf häusliche Krankenpflegeleistungen haben, die von
der gesetzlichen Krankenversicherung zu finanzieren sind. Aus Sicht des
Gerichtes dürfen Menschen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe nicht
schlechter gestellt werden, als Betroffene, die in ihrem eigenen
Haushalt leben.
Das
Bundessozialgericht hat in zwei Verfahren entschieden, dass
Einrichtungen der Eingliederungshilfe ein "sonst geeigneter Ort" im
Sinne des § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V sein können, so dass die dortigen
Bewohner Anspruch auf häusliche Krankenpflegeleistungen haben, die von
der gesetzlichen Krankenversicherung zu finanzieren sind. Aus Sicht des
Gerichtes dürfen Menschen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe nicht
schlechter gestellt werden, als Betroffene, die in ihrem eigenen
Haushalt leben.
Nach Auffassung des BSG sind Einrichtungen der
Eingliederungshilfe nur soweit verpflichtet, medizinische
Behandlungspflege zu erbringen, wie sie dazu aufgrund der von ihnen
vorzuhaltenden sächlichen und personellen Ausstattung in der Lage sind.
Die Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege habe vorrangig
durch die gesetzlichen Krankenkassen zu erfolgen. Die Sozialhilfeträger
sind nicht dazu verpflichtet, in den Verträgen mit den Einrichtungen zu
vereinbaren, dass diese Behandlungspflege zu erbringen haben.
Eingliederungshilfeeinrichtungen sind aus Sicht des
Gerichtes nur zur Erbringung einfacher medizinischer Behandlungspflege
verpflichtet, wozu das BSG das Bereitstellen und Verabreichen von
Medikamenten und Blutdruckmessungen zählt. Die in den Verfahren
weiterhin zu erbringenden Leistungen des Wechselns von Wundverbänden und
Verabreichens von Injektionen wertet das Gericht hingegen als
qualifizierte Behandlungspflege, deren Erbringung von Fachpersonal aus
den Bereichen Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Pädagogik nicht
geschuldet wird.
Hinweis:
Die Urteilsbegründungen liegen in beiden Verfahren
noch nicht vor. Das BSG hat die wesentlichen Inhalte der Urteile in
seiner Medieninformation Nr. 3/15 veröffentlicht. Schon jetzt ist
festzustellen, dass Bewohner von Behindertenhilfeeinrichtungen einen
Anspruch auf die Erbringung von qualifizierter Behandlungspflege
zulasten der gesetzlichen Krankenkassen haben.
Behindertenhilfeeinrichtungen sind nur dann dazu verpflichtet, diese
Leistungen selbst zu erbringen oder die Vergütung beauftragter
Pflegedienste selbst zu tragen, wenn sie die Erbringung qualifizierter
Behandlungspflege im Wohn- und Betreuungsvertrag mit dem Betroffenen
vereinbart haben.
(Urteil des Arbeitsgerichts Berlin vom 04.03.2015, 54 Ca 14420/14)
Am 01.01.2015 ist das neue Mindestlohngesetz in
Kraft getreten. Hiernach hat jeder in Deutschland Beschäftigte Anspruch
auf ein Arbeitsentgelt von mindestens 8,50 € pro Stunde. Der Gesetzgeber
hat nicht näher geregelt, ob Sonderzahlungen auf den Mindestlohn
angerechnet werden dürfen.
Die Klägerin erhielt von der Beklagten vor
Einführung des Mindestlohns einen Grundlohn von 6,44 € pro Stunde sowie
eine Leistungszulage und Schichtzuschläge. Ferner erhielt sie
Urlaubsgeld und eine jährliche Sonderzahlung. Die Beklagte kündigte das
Arbeitsverhältnis im Wege einer Änderungskündigung und bot zugleich
einen Stundenlohn von 8,50 € an, wobei die zusätzliche Leistungszulage,
das Urlaubsgeld und die Jahressonderzahlung wegfallen sollten.
Das Arbeitsgericht Berlin entschied, dass eine
Anrechnung von zusätzlich zum Urlaubsentgelt gezahltem Urlaubsgeld und
einer jährlichen Sonderzahlung auf den Mindestlohn nicht zulässig ist.
Ferner sei eine hierauf gerichtete Änderungskündigung des Arbeitgebers
unzulässig.
Nach Auffassung des Gerichts stellt der
gesetzliche Mindestlohn das Entgelt für die Arbeitsleistung der
Arbeitnehmer dar. Leistungen wie das Urlaubsgeld und die
Jahressonderzahlung dienen nicht diesem Zweck und dürfen daher nicht auf
das Entgelt angerechnet werden.
Anmerkung:
Das Arbeitsgericht Berlin
dürfte eine der ersten Entscheidungen zu dieser Fragestellung getroffen
haben. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Rechtsauffassung weitere
Arbeitsgerichte und insbesondere die weiteren Instanzen folgen werden.
Die Entscheidung liegt derzeit noch nicht im
Volltext vor. Die Zusammenfassung ist in der Pressemitteilung 5/15 des
Arbeitsgerichts Berlin nachzulesen.
(Beschluss des BGH vom 17.09.2014, XII ZB 202/13)
 Der
Bundesgerichtshof hatte die Frage zu entscheiden, ob lebenserhaltende
Maßnahmen bei einer seit 2009 im Wachkoma befindlichen Betroffenen
beendet werden durften.
Der
Bundesgerichtshof hatte die Frage zu entscheiden, ob lebenserhaltende
Maßnahmen bei einer seit 2009 im Wachkoma befindlichen Betroffenen
beendet werden durften.
Der Ehemann und die Tochter der Betroffenen waren zu
ihren gesetzlichen Betreuern bestellt worden, nachdem diese im Jahr
2009 eine Gehirnblutung mit der Folge eines Wachkomas erlitten hatte.
Sie wurde über eine Magensonde künstlich ernährt. Eine Kontaktaufnahme
mit ihr war nicht möglich. Die gesetzlichen Betreuer stellten beim
zuständigen Amtsgericht den Antrag auf Genehmigung der Einstellung der
lebenserhaltenden Maßnahmen. Eine schriftliche Patientenverfügung lag
nicht vor. Der Ehemann der Betroffenen hatte im September 2009 noch die
entsprechenden Formulare für eine Patientenverfügung beschafft. Diese
wurden jedoch nicht mehr ausgefüllt. Die Betroffene hatte sich aber vor
ihrer Erkrankung häufiger dahingehend geäußert, dass sie bei einer
schweren Erkrankung keine lebenserhaltenden Maßnahmen wünsche. Mit der
behandelnden Ärztin bestand Einvernehmen über die Einstellung der
künstlichen Ernährung.
Das zuständige Amtsgericht und Landgericht lehnten
die Einstellung der lebenserhaltenden Maßnahmen ab. Die Rechtsbeschwerde
der gesetzlichen Betreuer gegen diesen Entscheidungen beim BGH hatte
Erfolg.
Der BGH bestätigte zunächst, dass der Antrag der
gesetzlichen Betreuer auf Genehmigung des Abbruchs der künstlichen
Ernährung an das Betreuungsgericht erforderlich gewesen war, da keine
schriftliche Patientenverfügung vorlag.
Aus Sicht des Gerichts war das Betreuungsgericht bei
der Entscheidung über die Beendigung lebensverlängernder Maßnahmen dazu
verpflichtet gewesen, frühere mündlich geäußerte Behandlungswünsche der
Betroffenen zu berücksichtigen. Es war dann zu prüfen, ob es sich bei
den Äußerungen der Betroffenen gegenüber Dritten tatsächlich um
Behandlungswünsche gehandelt hatte.
Der mutmaßliche Wille des Betroffenen sei anhand
konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln, wenn sich ein auf die aktuelle
Lebens- und Behandlungssituation bezogener Wille des Betroffenen nicht
feststellen lässt. Dazu seien insbesondere frühere mündliche oder
schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und
sonstige persönliche Wertevorstellungen des Betroffenen heranzuziehen.
Nach Auffassung des BGH war das Landgericht zu
Unrecht davon ausgegangen, dass wegen des nicht unmittelbar
bevorstehenden Todes der Betroffenen noch strengere Beweisanforderungen
an die Feststellung des mutmaßlichen Patientenwillens anzusetzen waren
als üblicherweise.
Zusammenfassung der Rechtsprechung seit 2012
Das Landgericht Freiburg verurteilte eine Bewohnerin
zum Auszug aus der Einrichtung, nachdem diese wiederholt gegen das im
Bewohnerzimmer geltende Rauchverbot verstoßen hatte. Das Gericht sah
dies als schuldhaften gröblichen Verstoß gegen die vertraglichen
Pflichten an, der nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 WBVG einen fristlosen
Kündigungsgrund darstellt. Aus Sicht des Gerichts war der Begriff des
"schuldhaften" Pflichtenverstoßes nicht im Sinne einer strafrechtlichen
Schuldfähigkeit zu interpretieren. Vielmehr reichte hierfür ein
"Verstehen" der konkreten Situation durch die Bewohnerin aus (LG
Freiburg, Urteil vom 05.07.2012, 3 S 48/12).
Das Landgericht Kleve stellte klar, dass bei einem
Streitwert über 5.000,- € das Landgericht das für Räumungsklagen
erstinstanzlich zuständige Gericht ist. Für Streitigkeiten um die
Wohnraummiete sind unabhängig vom Streitwert die Amtsgerichte zuständig.
Aus Sicht des Landgerichts unterfallen Wohn- und Betreuungsverträge
aber nicht dem Wohnraummietrecht, da hierbei Pflege und Betreuung der
Bewohner im Vordergrund stehen. Das Landgericht verurteilte eine
behinderte Frau zum Auszug aus der Einrichtung, nachdem über Jahre rund
90.000,- € an offenen Heimentgelten aufgelaufen waren, von denen der
Sozialhilfeträger ledig 3/4 übernahm. Die Einrichtung hatte vor der
Kündigung der Bewohnerin die erforderliche Mahnung mit Fristsetzung zur
Zahlung und Androhung der Kündigung nach § 12 Abs. 3 WBVG übersandt.
Nach erfolglosem Fristablauf sprach sie die fristlose Kündigung
gegenüber der Bewohnerin aus (LG Kleve, Urteil vom 26.05.2012, 3 O
15/12).
Das Landgericht Essen bestätigte die fristlose
Kündigung, die eine Pflegeeinrichtung gegenüber einem Bewohner
ausgesprochen hatte, der zuvor eine Mitbewohnerin sexuell belästigt
hatte. Das Gericht sah hierin einen schuldhaften gröblichen Verstoß
gegen die vertraglichen Pflichten, der nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 WBVG einen
fristlosen Kündigungsgrund darstellt. Die Einrichtung konnte aufgrund
der Zeugenaussagen von Mitarbeitern im Prozess nachweisen, dass der
Bewohner die Mitbewohnerin gegen ihren Willen sexuell belästigt hatte.
Dies sah das Gericht als massiven Verstoß gegen die
Persönlichkeitsrechte der Mitbewohnerin an. Das Gericht wertete dagegen
die Interessen des Bewohners am Verbleib in der Einrichtung als nicht
gleichwertig schützenswert, trotz seines hohen Alters und der Tatsache,
dass seine Ehefrau immer noch in der Einrichtung wohnte (LG Essen,
Urteil vom 18.03.2013, 1 O 181/12).
Das Landgericht Köln bestätigte die fristlose
Kündigung wegen Zahlungsverzugs sowie den Zahlungs- und Räumungsanspruch
eines Pflegeheimbetreibers. Dieser hatte im Kündigungsschreiben
lediglich einen offenen Gesamtbetrag angegeben, dessen Höhe fehlerhaft
berechnet war. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Kündigung
ausreichend begründet ist, wenn der offene Gesamtbetrag angegeben ist.
Eine detaillierte Aufschlüsselung der offenen Einzelposten in der
Kündigung sei nicht erforderlich. Außerdem sei es unerheblich, wenn sich
die Einrichtung bei der Höhe des offenen Gesamtbetrags verrechnet habe,
solange die Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 Nr. 4 b WBVG auch bei
Zugrundelegung des korrekten Betrags erfüllt seien, was im zu
entscheidenen Rechtsstreit der Fall war (LG Köln, Urteil vom 25.09.2014,
37 O 76/14).
Weitere Informationen finden Sie in unserer Mandanteninfo.
Fotos © Dirk Felmeden (Bundessozialgericht), Joe Miletzki (Bundesgerichtshof)