
03/2018Neues aus der RechtsprechungDas persönliche Budget bringt keine Leistungsausweitung von Eingliederungshilfeleistungen.(Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 22.02.2018, L 7 SO 3516/14)
Die schwerst mehrfach behinderte Klägerin wollte aus dem Elternhaus in ein inklusives Wohnprojekt umziehen. Die Eltern beantragten Leistungen im persönlichen Budget und begehrten Leistungen im Umfang von rund 3.700,- € monatlich für die Beschäftigung diverser Fach- und Hilfskräfte, die eine Betreuung der Klägerin sicherstellen sollten. Der Sozialhilfeträger bewilligte Leistungen der Eingliederungshilfe im persönlichen Budget in Höhe von monatlich 2.700,- €, die der Höhe um rund 20% über den Leistungen im stationären Wohnen lagen. Die Eltern der Klägerin legten Widerspruch gegen den Bescheid des Beklagten ein und begründeten ihn damit, dass die Klägerin mit dem bewilligten Leistungsumfang nicht in der Lage sei, ihren Bedarf zu decken. Sie benötige eine 24-Stunden-Betreuung und teilweise eine 1:1-Betreuung. Das Wunsch- und Wahlrecht der Klägerin nach § 9 Abs. 1 SGB XII sei nicht berücksichtigt worden. Ferner verstoße die zu geringe Leistungsbewilligung gegen Art. 19 a) UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Widerspruch und Klage vor dem Sozialgericht Freiburg hatten keinen Erfolg. Mit der Berufung begehrte die Klägerin u.a. die Feststellung, dass der Bescheid des Sozialamts rechtswidrig war und sie in ihren Rechten verletzt hatte. Das LSG Baden-Württemberg gab der Berufung im genannten Umfang statt, da das Sozialamt zwar Leistungen bewilligt hatte, die der Höhe nach ungefähr denen von stationären Einrichtungen entsprachen, in seinem Bescheid aber nicht hinreichend dargelegt hatte, dass es sich auf die Anwendung des Mehrkostenvorbehalts der §§ 9 Abs. 2 und 13 Abs. 1 SGB XII stützte. Das Sozialamt hätte die Klägerin über gleich geeignete und tatsächlich zur Verfügung stehende stationäre und ambulante Einrichtungen informieren müssen. Dies gelte trotz der Tatsache, dass die Klägerin die Suche nach Alternativen von vornherein abgelehnt hatte. Das LSG stellte aber zugleich klar, dass der Klägerin Leistungen in der von ihr begehrten Höhe nicht zustehen. Beim persönlichen Budget handele es sich nicht um eine andere Leistungsart, sondern um eine alternative Leistungsform (Auszahlung an die Betroffenen anstelle des Sachleistungsprinzips). Die Höhe des persönlichen Budgets darf die Kosten, die der Klägerin außerhalb des persönlichen Budgets bewilligt worden wären, nicht übersteigen (§ 29 Abs. 2 Satz 7 SGB IX). Bei der Leistungsbewilligung ist zwar auf die Wünsche der Klägerin Rücksicht zu nehmen, zugleich soll ihnen aber in der Regel nicht entsprochen werden, wenn damit unverhältnismäßige Mehrkosten verbunden sind (§ 9 Abs. 2 Satz 3 SGB XII; sog. Mehrkostenvorbehalt). Dies ist aber vorliegend nach Auffassung des Gerichts der Fall, da die eingeforderte Leistung erheblich über den vergleichbaren stationären Kosten liegt. Das LSG Baden-Württemberg führt weiter aus, dass Art. 19 UN-BRK selbst keine Anspruchsgrundlage für Sozialleistungen ist und die Mehrkostenvorbehalte in §§ 9 Abs. 2 und 13 Abs. 1 SGB XII dadurch nicht gegenstandslos werden. Im Sozialhilferecht seien für die Bemessung des persönlichen Budgets die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen des zuständigen Sozialhilfeträgers nach § 75 Abs. 3 SGB XII maßgeblich. Eine mit höheren Kosten verbundene Vereinbarung zwischen dem Leistungsberechtigten und dem Leistungserbringer könne bei der Bemessung des persönlichen Budgets in aller Regel nicht berücksichtigt werden. Anmerkung: Das Urteil stellt noch einmal klar, dass die Bewilligung von Leistungen der Eingliederungshilfe im persönlichen Budget ihrer Höhe nach auf vergleichbare Leistungen nach dem Sachleistungsprinzip im ambulanten und stationären Bereich begrenzt ist. Über das persönliche Budget können die Betroffenen keine erheblich höheren Leistungen gegenüber den Sozialhilfeträgern durchsetzen. Auch Art. 19 UN-BRK begründet keine Ansprüche der Betroffenen unabhängig von der Höhe der Kosten zulasten der Allgemeinheit. Der Einsatz von einer Pflegekraft auf 50 Bewohner*innen im Nachtdienst reicht keinesfalls aus.(Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus vom 22.11.2017, 5 L 294/17)
Die Heimaufsicht hatte im Januar 2019 an zwei Tagen die Einrichtung besucht und dabei diverse Mängel festgestellt. U.a. wurde festgestellt, dass nachts für 50 bis 60 Bewohner*innen, hiervon rund 20 Personen mit hohem Pflegebedarf (Pflegegrade 4 und 5), lediglich eine Pflegekraft über mehrere Stockwerke im Einsatz war. Auch tagsüber war die Einrichtung deutlich unterbesetzt. Das Verwaltungsgericht Cottbus kam u.a. zu dem Ergebnis, dass die Besetzung der Einrichtung mit nur einer Pflegekraft im Nachtdienst einen evidenten Mangel im Sinne des § 21 Absatz 1 Brandenburgisches Pflege- und Betreuungswohngesetz (BbgPBWoG) darstellt. Neben weiteren Mängeln wertete das Gericht auch die zu geringe Größe einiger Doppelzimmer als Mangel. Teilweise bestritt die Einrichtung die Mängel, teilweise blieben diese aber auch unbestritten. Das Gericht war der Auffassung, dass die Einrichtung jedenfalls hinsichtlich der unbestrittenen Mängel dem Auskunftsersuchen der Heimaufsicht im Rahmen des § 22 Absatz 1 BbgPBWoG nachzukommen hatte. Zugleich stellte das Gericht fest, dass hinsichtlich bestrittener Mängel kein Auskunftsverlangen geltend gemacht werden kann, da es in diesem Fall keinen Sinn macht, weil das Auskunftsverlangen mangels Einsichtsbereitschaft der Einrichtung, dass Mängel vorliegen, ins Leere gehen würde und eine Beratung durch die Heimaufsicht nach § 22 Absatz 1 BbgPBWoG dadurch nicht möglich wäre. Hinweis: Das Gericht hat klar gestellt, dass zu geringer Personaleinsatz auch in Zeiten des Fachkräftemangels heimrechtlich einen Mangel darstellt, den die Heimaufsicht sanktionieren kann. Dies gilt für Einrichtungen der Behindertenhilfe ebenso wie für Pflegeeinrichtungen. Zur Vermeidung drastischerer Maßnahmen der Heimaufsicht nach §§ 23 ff. BbgPBWoG bzw. vergleichbarer landesheimrechtlicher Regelungen in anderen Bundesländern erscheint es angeraten, im Rahmen der Beratungsverpflichtung der Heimaufsicht erbetene Auskünfte zu erteilen. Neues aus der GesetzgebungDie wichtigsten Änderungen des Mutterschutzgesetzes (Teil 1)
Am 01.01.2018 ist das reformierte Mutterschutzgesetz (MuSchG) in Kraft getreten, das diverse Anpassungen und Neuregelungen im Bereich des Schutzes von schwangeren und stillenden Frauen brachte. In diesem und dem Newsletter Behindertenhilfe 04/2018 werden Ihnen die wesentlichen Neuregelungen vorgestellt. Gemäß § 1 MuSchG wurde der Anwendungsbereich des Gesetzes auf alle beschäftigten Frauen im sozialversicherungsrechtlichen Sinne erweitert. Ausdrücklich mit aufgenommen wurden Schülerinnen, Studentinnen, Praktikantinnen, Beschäftigte in Behindertenwerkstätten, Frauen im Bundes- oder Jugendfreiwilligendienst und Mitarbeiterinnen einer geistigen Genossenschaft. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 MuSchG muss ein Arbeitgeber der Mutter auf Antrag eine verlängerte nachgeburtliche Schutzfrist von 12 Wochen gewähren, wenn sie ein behindertes Kind geboren hat. Der Nachweis über die Behinderung des Kindes i.S.d. § 2 SGB IX muss innerhalb von acht Wochen nach der Geburt durch ein ärztliches Attest erbracht werden. Wie bisher ist Mehrarbeit für schwangere und stillende Frauen untersagt. Über 18jährige Frauen dürfen maximal 8,5 Stunden am Tag bzw. 90 Stunden innerhalb von zwei Wochen beschäftigt werden. Bei unter 18jährigen Frauen ist die tägliche Arbeitszeit auf 8 Stunden begrenzt. Sie dürfen maximal 80 Stunden in zwei Wochen beschäftigt werden. Der Arbeitgeber muss eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden gewähren (§ 4 MuSchG). Schwangere und stillende Frauen dürfen zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr nicht beschäftigt werden. Für alle Berufsgruppen gilt jetzt, dass der Arbeitgeber für eine Beschäftigung zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr eine Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Behörde beantragen kann, wenn
Weitere Ausnahmegenehmigungen für den Einzelfall sind in § 29 Abs. 3 Nr. 1 MuSchG geregelt. Es besteht das grundsätzliche Verbot, schwangere und stillende Frauen an Sonn- und Feiertagen zu beschäftigen. Allerdings kann sich die betroffene Frau ausdrücklich im Rahmen der Regelungen des Arbeitszeitgesetzes dazu bereit erklären, auch an Sonn- und Feiertagen tätig zu werden (§ 6 MuSchG). Es muss insbesondere sichergestellt werden, dass die betroffene Frau nicht alleine arbeitet. Ihr ist pro Arbeitswoche dann ein Ersatzruhetag zu gewähren. Neu geregelt wurde, dass eine stillende Mutter nur noch in den ersten zwölf Monaten nach der Entbindung (bisher nicht zeitlich begrenzt) einen Anspruch auf Freistellung zum Stillen in bestimmten zeitlichen Grenzen täglich hat (§ 7 Abs. 2 MuSchG). Über unsere aktuellen Seminar- und Vortragsthemen können Sie sich auf unseren Internetseiten informieren.www.vandrey-hoofe.de/veranstaltungen/
Logos: © Baden-Württemberg und Land Brandenburg Klicken Sie hier, wenn Sie den Newsletter Behindertenhilfe abbestellen möchten. |

|
Impressum: Christine Vandrey & Barbara Hoofe |
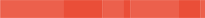


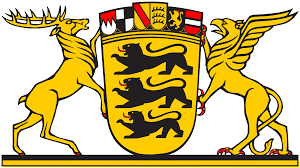 Das
Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg hatte darüber zu
entscheiden, in welchem Umfang der Klägerin
Eingliederungshilfeleistungen im persönlichen Budget zustehen.
Das
Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg hatte darüber zu
entscheiden, in welchem Umfang der Klägerin
Eingliederungshilfeleistungen im persönlichen Budget zustehen.
 Das
Verwaltungsgericht Cottbus hatte im einstweiligen Rechtsschutz zu
klären, ob eine Pflegeeinrichtung einstweilen bis zur Entscheidung im
Klageverfahren Auskünfte gegenüber der Aufsicht für unterstützende
Wohnformen (Heimaufsicht) des Landes Brandenburg verweigern durfte.
Das
Verwaltungsgericht Cottbus hatte im einstweiligen Rechtsschutz zu
klären, ob eine Pflegeeinrichtung einstweilen bis zur Entscheidung im
Klageverfahren Auskünfte gegenüber der Aufsicht für unterstützende
Wohnformen (Heimaufsicht) des Landes Brandenburg verweigern durfte.