
04/2018Neues aus der RechtsprechungDer Wunsch des Betroffenen hinsichtlich der Person des gesetzlichen Betreuers hat Vorrang.(Bundesgerichtshof, Beschluss vom 28.03.2018, XII ZB 558/17)
Die Betroffene, die an einer Intelligenzminderung leidet, lebt gemeinsam mit ihrer Nichte und deren Lebensgefährten in einem Haus auf dem Land. Eine Mitarbeiterin des Betreuungsvereins war zur gesetzlichen Betreuerin bestellt worden. Sie konnte keinen persönlichen Kontakt mit der Betroffenen pflegen, da ihr der Zugang zum Hof verwehrt worden war. Entgegen dem Willen der Betroffenen und ihrer Nichte war die Bestellung der Mitarbeiterin des Betreuungsvereins zur Betreuerin nach zwei Jahren verlängert worden. Die hiergegen eingelegte Beschwerde wies das zuständige Landgericht mit der Begründung zurück, dass die Nichte zu Recht nicht zur Betreuerin bestellt worden war. Die bereits von Beginn der Betreuung an bestehenden Bedenken gegen deren Eignung als Betreuerin seien weiterhin gegeben. Es bestehe nach wie vor der Eindruck, dass die dominante Nichte die leicht zu beeinflussende und zu manipulierende Betroffene von der Außenwelt abschirme, die Betroffene eigene Bedürfnisse aus Angst vor der Nichte nicht äußere und sich deren Anordnungen auch gegen ihre eigenen Wünsche füge. Der BGH hob die Entscheidung des Landgerichts auf. Er führte aus, dass das Gericht gemäß § 1897 Absatz 4 Satz 1 BGB dem Vorschlagsrecht der betroffenen Person hinsichtlich der Benennung eines gesetzlichen Betreuers zu folgen hat. Es sei die Person zum Betreuer zu bestellen, die der Betroffene wünscht. Der Wille des Betroffenen könne nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn die Bestellung der vorgeschlagenen Person seinem Wohl zuwiderlaufe. Dies setze voraus, dass gewichtige Gründe vorliegen, die gegen die Bestellung der vorgeschlagenen Person sprechen. Es müsse die konkrete Gefahr bestehen, dass die vorgeschlagene Person die Betreuung der Betroffenen nicht zu deren Wohl führen würde. Die Einwände des Landgerichts ließ der BGH nicht gelten. Aus seiner Sicht sei hier nur ein "Eindruck" geschildert, nicht aber konkrete Vorfälle, die die Befürchtung untermauern würden, dass die Betreuung durch die Nichte nicht zum Wohl der Betroffenen erfolgen würde. Ferner werde diese im Rahmen der betreuungsgerichtlichen Kontrolle ausreichend kontrolliert. Das Landgericht habe auch die Prüfung unterlassen, ob nicht jedenfalls die Übertragung einzelner Aufgabenkreise auf die Nichte in Betracht komme, während andere bei der Betreuuerin des Betreuungsvereins verbleiben. Anmerkung: Der BGH hat die Rechte der Betroffenen weiter gestärkt, selbst entscheiden zu können, wer deren gesetzlicher Betreuer sein soll. Das Gericht hat hier auch nochmal klar gestellt, dass diese Entscheidungskompetenz unabhängig von einer Geschäfts- oder Einsichtsfähigkeit gegeben ist. Zweifelhaft ist allerdings die Auffassung des BGH, dass ehrenamtliche Angehörigenbetreuer in ausreichendem Maße durch die Betreuungsgerichte überprüft werden. Hier ergibt sich aus der Praxis eher ein gegenteiliger Eindruck. Der Urlaubsanspruch für nicht genommenen (Mindest-)Urlaub verfällt nicht automatisch zum Jahresende.(Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 06.11.2018, C-684/16)
Der Entscheidung lag der Fall zugrunde, dass ein befristet beschäftigter Mitarbeiter, dessen Arbeitsverhältnis zum Ende des Jahres 2013 endete, vom Arbeitgeber aufgefordert worden war, verbliebene 53 Urlaubstage in den Monaten November und Dezember zu nehmen. Er nahm lediglich zwei Tage Urlaub und verlangte nach Ablauf des Kalenderjahres und Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Abgeltung des restlichen Urlaubsanspruchs von 51 Tagen. Das Arbeitsgericht München und das Landesarbeitsgericht München gaben dem klagenden Arbeitnehmer Recht. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) sah hier einen Widerspruch zur Regelung des § 7 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), wonach ein Arbeitnehmer den Urlaub beantragen muss, damit der Anspruch nicht zum Jahresende verfällt. Das BAG legte dem EuGH diese Frage zur Entscheidung vor. Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass jedenfalls der vierwöchige gesetzliche Mindesturlaub nicht schon deshalb verfallen kann, weil der Arbeitnehmer keinen Urlaubsantrag gestellt hat. Die Arbeitgeber seien in diesem Fall in der Pflicht, die Arbeitnehmer*innen rechtzeitig vor Ablauf des Jahres aufzufordern, den Urlaub zu nehmen und darauf hinzuweisen, dass der Urlaub anderenfalls verfällt. Allerdings seien die Arbeitgeber nicht dazu verpflichtet, Urlaub vor dem Jahresende zwangsweise anzuordnen. Anmerkung: Die Sache ist nun wieder ans Bundesarbeitsgericht zurückgegangen, das jetzt den konkreten Fall abschließend entscheiden muss und hierbei Kriterien aufstellen muss, in welchem Umfang und auf welche Weise Arbeitgeber die Mitarbeiter*innen über den drohenden Verfall des Mindesturlaubs informieren müssen. Das Urteil bezieht sich ausschließlich auf den vierwöchigen gesetzlichen Mindesturlaub. In Arbeitsverträgen können für darüber hinausgehenden Urlaub abweichende Regelungen aufgenommen werden. Hinsichtlich noch nicht genommenen Mindesturlaubs ist es zukünftig angeraten, die Mitarbeiter*innen rechtzeitig vor Ablauf des Jahres auf offene Mindesturlaubsansprüche und deren Verfall zum Jahresende schriftlich hinzuweisen. Neues aus der GesetzgebungDie wichtigsten Änderungen des Mutterschutzgesetzes (Teil 2)
Am 01.01.2018 ist das reformierte Mutterschutzgesetz (MuSchG) in Kraft getreten, das diverse Anpassungen und Neuregelungen im Bereich des Schutzes von schwangeren und stillenden Frauen brachte. Der hiesige Beitrag setzt die bereits im Newsletter Behindertenhilfe 03/2018 begonnene Darstellung der wesentlichen Neuregelungen fort. Gemäß § 9 MuSchG haben Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Gefährdungen einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes möglichst vermieden werden und eine "unverantwortbare" Gefährdung ausgeschlossen wird. Es muss eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitsbedingungen der betroffenen Personenkreise vorgenommen werden und ggf. müssen Schutzmaßnahmen nach § 10 MuSchG getroffen werden. Für die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung gilt nun § 14 MuSchG. Alte Gefährdungsbeurteilungen müssen hierauf umgestellt werden. Wird eine "unverantwortbare" Gefährdung festgestellt, hat der Arbeitgeber Maßnahmen in folgender Reihenfolge durchzuführen:
Neu eingeführt wurde in § 17 Absatz 1 Nr. 2 MuSchG ein viermonatiger Kündigungsschutz, falls die schwangere Frau nach der 12. Woche eine Fehlgeburt erleidet. Das Verbot umfasst auch die Vorbereitungsmaßnahmen einer Kündigung. Nach Beendigung eines Beschäftigungsverbots haben die betroffenen Arbeitnehmerinnen Anspruch auf Beschäftigung (§ 25 MuSchG). Ein entsprechender Arbeitsplatz ist freizuhalten. Arbeitgeber müssen das neue Mutterschutzgesetz allen Arbeitnehmerinnen bekannt machen ( § 26 MuSchG). Dies kann durch Aushang oder Auslage erfolgen ebenso wie durch Zugänglichmachung in einem für alle Arbeitnehmerinnen zugänglichen elektronischen Verzeichnis. Der Bußgeldkatalog wurde angepasst. U.a. wurde in § 32 Nr. 6 MuSchG der Verstoß gegen die Pflicht zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung neu aufgenommen. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Foto: © Joe Miletzki (Bundesgerichtshof); Europäischer Gerichtshof Klicken Sie hier, wenn Sie den Newsletter Behindertenhilfe abbestellen möchten. |

|
Impressum: Christine Vandrey & Barbara Hoofe |
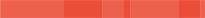


 Der
Bundesgerichtshof (BGH) hatte darüber zu entscheiden, ob die
Verlängerung der Bestellung einer Berufsbetreuerin rechtmäßig war oder
ob alternativ die Nichte der Betroffenen zur gesetzlichen Betreuerin zu
bestellen war.
Der
Bundesgerichtshof (BGH) hatte darüber zu entscheiden, ob die
Verlängerung der Bestellung einer Berufsbetreuerin rechtmäßig war oder
ob alternativ die Nichte der Betroffenen zur gesetzlichen Betreuerin zu
bestellen war.
 Der
Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte darüber zu entscheiden, ob der
Urlaubsanspruch für Mitarbeiter*innen verfällt, die bis zum Ende des
Kalenderjahres ihren Urlaub nicht beantragt haben.
Der
Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte darüber zu entscheiden, ob der
Urlaubsanspruch für Mitarbeiter*innen verfällt, die bis zum Ende des
Kalenderjahres ihren Urlaub nicht beantragt haben.