
02/2021Neues aus der RechtsprechungAssistenznehmer, bei denen die ernsthafte Gefahr zur Selbstschädigung besteht, müssen vor diesen Gefahren besonders geschützt werden.(BGH, Urteil v. 14.01.2021, III ZR 168/19)
Der verstorbene Bewohner litt unter einer Demenz aufgrund des Korsakow-Syndroms. Er war weder zeitlich, noch räumlich oder örtlich orientiert. Phasenweise war er zur eigenen Person nicht orientiert. Bei Einzug ins Pflegeheim erhielt er ein Zimmer im obersten Stockwerk, das über zwei Dachfenster verfügte, die vom Boden aus 1,2 Meter hoch lagen. Die Fenster waren nicht besonders gesichert. Darunter befanden sich eine Bank und ein Heizkörper, die das Hinaufsteigen zum Fenster und das Hinausklettern aufs Dach ermöglichten. In einem unbeaufsichtigten Moment stieg der Bewohner aufs Dach und stürzte von da aus zu Tode. Der BGH geht davon aus, dass der Leistungserbringer im Voraus eine Risikoprognose für den Bewohner hätte durchführen müssen um einzuschätzen, ob er sich ohne Sicherungsmaßnahmen hätte selbst schädigen können. Aus Sicht des Gerichts ist dabei auch zu beachten, dass bereits eine Gefahr, deren Verwirklichung nicht sehr wahrscheilich ist, aber zu besonders schweren Folgen führen kann, geeignet ist, Sicherungspflichten beim Leistungserbringer auszulösen. Nach Auffassung des BGH darf daher ein Bewohner, bei dem eine Selbstschädigungsgefahr erkennbar ist, nicht in einem Zimmer untergebracht werden, in dem er über einfach zu erreichende und ungesicherte Fenster auf das Dach steigen kann. Gerade bei Bewohnern, die an einer hochgradigen Demenz leiden, seien solche unkontrollierten und unkalkulierbaren Handlungen, wie sie der Kläger vorgenommen hatte, zu erwarten. Zur Klärung noch offener Fragen verwies der BGH das Verfahren zurück an die zweite Instanz. Anmerkung: Der BGH setzt seine Rechtsprechung fort, wonach (nur) bei absehbaren, erheblichen und vom Assistenznehmer nicht zu beherrschenden Risiken einer Selbstschädigung präventive Sicherungsmaßnahmen durch den Leistungserbringer durchzuführen sind. Das bedeutet zugleich, dass nicht bei jedem Assistenznehmer alle denkbaren Sicherungsmaßnahmen durchzuführen sind, um jedes mögliche Risiko auszuschließen. Das Selbstbestimmungsrecht der Assistenznehmer ist weiterhin zu wahren. Häufig hat der BGH Haftungsfragen im Hinblick auf Pflegeheime zu entscheiden. Diese Entscheidungen sind ebenso maßgeblich für die Leistungserbringer in der Behindertenhilfe. Zur Frage von Entschädigungsansprüchen wegen Quarantäne nach dem Infektionsschutzgesetz.(VG Koblenz, 2 Urteile vom 10.05.2021, 3 K 107/21.KO und 3 K 108/21.KO) Das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz hatte darüber zu entscheiden, ob einem Arbeitgeber Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz für zwei Arbeitnehmerinnen zustehen, die in 14tägige häusliche Quarantäne mussten. Der Arbeitgeber beantragte beim beklagten Land Rheinland-Pfalz die Erstattung von Entschädigungszahlungen, die er während der Zeit der Quarantäne an seine Mitarbeiterinnen für deren Verdienstausfall geleistet hatte sowie von Sozialversicherungsbeiträgen. Das Land gewährte lediglich für die Zeit ab dem sechsten Tag der Absonderung eine Erstattung mit dem Hinweis, die Mitarbeiterinnen hätten ggü. dem Arbeitgeber für die ersten fünf Tage der Quarantäne einen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Aus Sicht des VG Koblenz hat der Arbeitgeber für Quarantänezeiten seiner Mitarbeiterinnen nach dem Infektionsschutzgesetz grundsätzlich einen Anspruch auf Kostenerstattung. Dieser Anspruch scheide aber aus, da den Mitarbeiterinnen trotz ihrer Verhinderung an der Ausübung ihrer Tätigkeit gegen den Arbeitgeber ein Lohnfortzahlungsanspruch zusteht. Gemäß § 616 Satz 1 BGB besteht ein Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn der Arbeitnehmer für eine nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Dies sei hier der Fall gewesen. Bei den behördlichen Quarantäneanordnungen, die aufgrund eines Ansteckungsverdachts der Arbeitnehmerinnen der Klägerin ergangen sind, handelt es sich um ein in deren Person liegendes Leistungshindernis. Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob dieses Urteil Bestand haben wird und der Sachverhalt von anderen Verwaltungsgerichten ebenso entschieden wird. Typische Anwendungsfälle von § 616 Satz 1 BGB sind auch die kurzfristige unverschuldete Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers wegen eines Arztbesuchs, der Pflege eines erkrankten Kindes, der eigenen Eheschließung, der Geburt eines Kindes oder einer Zeugenaussage vor Gericht. Es ist möglich, die Regelung des § 616 BGB im Arbeitsvertrag abzubedingen. Kein Pflegegeld bei Unterbringung der Betroffenen im Pflegeheim eines Behindertenhilfeträgers.(LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 23.04.2021, L 4 P 3887/19) Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg hatte darüber zu entscheiden, ob der Klägerin bei Einzug in den Pflegebereich einer stationären Behindertenhilfeeinrichtung weiterhin am Wochenende anteilig Pflegegeld sowie der Mutter als Pflegeperson Rentenversicherungsbeiträge zustehen. Die Klägerin leidet an einer schweren Mehrfachbehinderung u.a. mit schwerer spastischer Tetraparese. Bei ihr ist der Pflegegrad 5 festgestellt. Sie zog in eine Behindertenhilfeeinrichtung ein, mit der sie zunächst einen Vertrag über Eingliederungshilfeleistungen abschloss. Die Einrichtung ist so strukturiert, dass sich im selben Gebäude ein als "Pflegeheim" bezeichneter Bereich befindet (sog. Binnendifferenzierung). Für diesen Bereich schloss der Leistungserbringer mit den zuständigen Pflegekassen einen Versorgungsvertrag nach dem SGB XI. In diesem Pflegeheim lebt die Klägerin. Die Pflegekasse zahlt 2.005,- € pro Monat als Anteil an den stationären Pflegeleistungen nach § 43 SGB XI an den Leistungserbringer. Die beklagte Pflegekasse stellte mit Einzug ins Pflegeheim die Zahlung von Pflegegeld an die Klägerin ein. Ebenso erhielt die Mutter der Klägerin als Pflegeperson nicht länger Beitragszahlungen zur Rentenversicherung durch die Pflegekasse. Die Klägerin erhob Klage und vertritt die Auffassung, dass der Schwerpunkt der Einrichtung weiterhin auf der Erbringung von Eingliederungshilfeleistungen liegt. Ferner hält sich die Klägerin an den Wochenenden zu Hause auf, wo die Mutter die erforderlichen sechs Stunden Pflegeleistungen täglich weiterhin erbringt. Das Sozialgericht und das Landessozialgericht wiesen die Klage ab. Der Einrichtungsteil, in dem die Klägerin lebt, sei eine Pflegeeinrichtung nach § 71 Absatz 2 SGB XI. Es wurden von dem Leistungserbringer Pflegesätze mit der Pflegeversicherung vereinbart. Der Abschluss des Versorgungsvertrags nach dem SGB XI schließe die Anwendung von § 71 Absatz 4 SGB XI in Verbindung mit § 43a SGB XI aus, die sonst für Behindertenhilfeeinrichtungen zur Anwendung kommen. Damit ist nach Auffassung des LSG die Pflegekasse nur zur Zahlung der vollstationären Pflegeleistungen verpflichtet und nicht auch zur Fortzahlung von Pflegegeld und Beiträgen zur Rentenversicherung. Anmerkung: In besonderen Wohnformen der Behindertenhilfe ist der Anteil, den die Pflegeversicherung zur Pflege zu zahlen hat, gemäß § 43a SGB XI auf maximal 266,- € pro Monat begrenzt. Die restliche Pflege muss von der Eingliederungshilfe getragen werden. Hier steht bei Menschen mit Behinderung, die sehr pflegebedürftig sind oder werden, immer die Frage im Raum, ob die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft oder die Pflege im Vordergrund steht. Die Deckelung der Pflegeleistungen nach § 43a SGB XI und die gesetzlich vorgeschriebene Differenzierung in zwei Systeme (Eingliederungshilfe oder Pflege) bringt den Betroffenen selbst letztlich nur Nachteile. Weitere Informationen über uns finden Sie auf www.vandrey-hoofe.deFoto: © Joe Miletzki (Bundesgerichtshof) Klicken Sie hier, wenn Sie den Newsletter Behindertenhilfe abbestellen möchten. |

|
Impressum: Christine Vandrey & Barbara Hoofe |
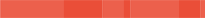

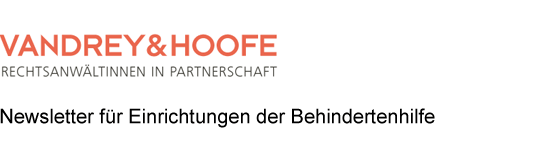
 Der
Bundesgerichtshof (BGH) hatte darüber zu entscheiden, ob der Ehefrau
eines verstorbenen Bewohners Schadensersatz und Schmerzensgeld zusteht,
weil der Bewohner in der Einrichtung vom Dach gestürzt und dadurch
verstorben war.
Der
Bundesgerichtshof (BGH) hatte darüber zu entscheiden, ob der Ehefrau
eines verstorbenen Bewohners Schadensersatz und Schmerzensgeld zusteht,
weil der Bewohner in der Einrichtung vom Dach gestürzt und dadurch
verstorben war.